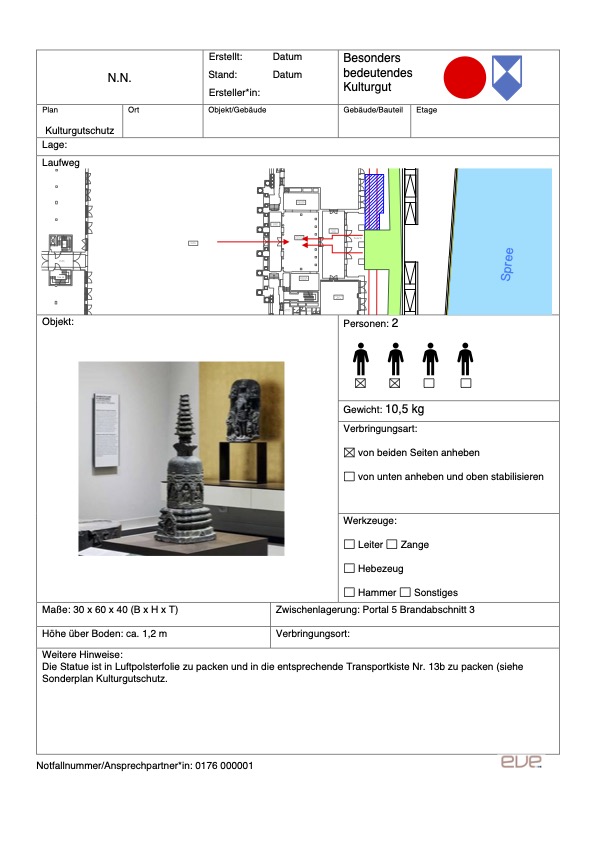Kulturgutschutz
Methoden der Risikoanalyse im Kulturgutschutz
Für den Kulturgutschutz mobiler Kulturgüter existieren unterschiedliche Risikobewertungssysteme. Neben der Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren oder der praktischen Anwendbarkeitkeit können die Bewertungssysteme vor allem methodisch in qualitative, semi-quantitative Modelle unterschieden werden. Bei den qualitativen Risikomodellen wird das Risiko durch eine nicht-numerische Schätzung definiert, die dazu dient, die zu untersuchenden Güter zu identifizieren und eine einfache und schnelle Bewertung vorzunehmen. Bei semi-quantitativen Methoden muss der Ergebniswert keine exakte Zahl sein. Die Methoden verwenden daher in der Regel relative Risikoskalen, um die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ereignissen und deren Folgen zu bestimmen. Quantitative Methoden betrachten die tatsächlichen Zahlen. Sie verwenden messbare, objektive Daten, um den Vermögenswert, die Verlustwahrscheinlichkeit und das Risiko zu bestimmen.
ABC-Methode
Die ABC-Methode wurde in Zusammenarbeit mit ICCROM, dem Canadian Conservation Institute (CCI) und der Netherlands Cultural Heritage Agency (RCE) von 2006 bis 2012 entwickelt. Das Modell erfolgt in drei Hauptschritten: Risiken identifizieren, Risiken analysieren und Risiken bewerten. Bei der Bewertung der Risiken werden die Risiken miteinander verglichen, mit den Kriterien und den Erwartungen. Das Modell ermittelt das spezifische Risiko auf einer logarithmischen Skala von 15 Punkten, wobei die drei Komponenten A (Häufigkeit oder Rate), B (Wertverlust jedes betroffenen Objekts) und C (betroffene Objekte) kombiniert werden, um die Messung der MR durch einfache Addition zu ermöglichen (MR = A + B + C).
SiLK
Primäres Ziel des Sicherheitsleitfadens Kulturgut (SiLK) ist die Prävention. Durch geeignete Maßnahmen soll ein Schadensereignis von vornherein möglichst verhindert bzw. die Eintrittswahrscheinlichkeit weitestgehend reduziert werden. Bei Notfällen dienen die in SiLK beschriebenen organisatorischen, baulichen und technischen Schutzmaßnahmen dazu, das Schadensausmaß möglichst gering zu halten. Dies gilt ebenso für Risiken, welche eine allmähliche Beschädigung, einen sozusagen „schleichenden Verfall“, bewirken oder begünstigen. Die empfohlenen Schutzmaßnahmen sind darauf ausgerichtet, die schädigende Wirkung auf das unvermeidbare Minimum (Restrisiko) zu beschränken. Eine Bewertung der Risiken der insgesamt 14 im Sicherheitsleitfaden identifizierten Gefährdungsquellen erfolgt durch eine systematische Auswertung von allgemeinen Fragen.
VdS 3511
Das Sicherheitskonzept stellt nach VdS 3511:2008-09 Sicherungsrichtlinien für Museen und Ausstellungshäuser im Allgemeinen eine Analyse möglicher Angriffs- und Schadensszenarien, mit dem Ziel ein definiertes Schutzniveau zu erreichen, dar. Die VdS 3511 verlangt eine strukturierte Vorgehensweise zur Bestimmung des zu schützenden Objektes und der Schutzziele und der Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes auf Basis von Schadenszenarien.
SAVIOR PRO-Verfahren
Die EVE Riskomatrix wurde bereits mehrfach sinnvoll im Kulturgutschutz angewandt. Die Risikomatrix verwendet das SAVIOR PRO-Verfahren, das für die Risikoanalyse komplexer Veranstaltungen entwickelt wurde. Mehr zur Anwendung finden sie bei eve risk GmbH.
SAVIOR PRO bietet die notwendige Unterstützung bei der Risikobewertung von Gefährdungen nach Schadenswahrscheinlichkeit (S) und Ausmaß des Schadens (A). Den fünf Schadenswahrscheinlichkeiten stehen genau fünf Ausmaßen des Schadens gegenüber. Daraus ergeben sich exakt 25 vorläufige Risikoeinschätzungen (V). Diese können durch ihre individuelle Risikobewertung (I) und die organisatorische Risikobewertung (O) positiv oder negativ beeinflusst werden. Die Risiken werden in den unterschiedlichen Stadien eines Veranstaltungsablaufs (Einlass, Veranstaltung und Ende) bzw. beim Kulturgutschutz Ausstellungsaufbau – Ausstellung – Umbau einzeln bewertet.